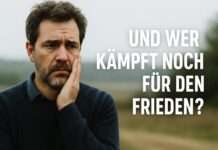An manchen Sonntagen liegt etwas in der Luft, das nach Vergangenheit riecht. Ein Geruch, der aus Kirchenbänken, altem Holz und schwerem Weihrauch aufsteigt und sich mit einer politischen Stimmung mischt, die längst überwunden schien. Genau davon erzählen die jüngsten Ereignisse in Verdun und verschiedenen spanischen Städten. Sie wirken wie Echos aus einer düsteren Ära und erinnern Europa daran, dass Geschichte selten schweigt.
Unterschiedliche Stimmen reden von religiösen Zeremonien, bloßen Gedenkgesten, harmlosen Traditionen. Doch viele Menschen spüren etwas anderes, fast wie ein Knistern im Raum: Die Idee, dass diese Messen nicht nur spirituelle Akte sind, sondern Botschaften. Und zwar solche, die eine alte, gefährliche Sprache sprechen.
In Verdun, diesem symbolträchtigen Ort des französischen Erbes, fanden sich Gläubige und Sympathisanten ein, um Philippe Pétain zu ehren. Ja, genau jenen Pétain, dessen Name untrennbar mit dem Vichy-Regime, Kollaboration, Antisemitismus und Unterdrückung verknüpft ist. Die Messe wurde zunächst untersagt, dann durch ein Gericht wieder erlaubt – ein juristisches Tauziehen, das Frankreich für ein paar Tage in Atem hielt.
Ein kleiner Absatz, nur um die Stimmung zu setzen.
In Spanien verhält es sich ähnlich. Dort tauchen Zeremonien, Messen, Gebete auf, die Francisco Franco oder prominente Funktionäre des Franquismus würdigen. Franco, dessen Diktatur die spanische Geschichte jahrzehntelang geprägt hat – mit Repression, Folter, politischer Säuberung.
All das klingt wie ein Kapitel, das Europa längst geschlossen glaubte. Und doch: Da ist es wieder, eines Sonntagmorgens, im Gewand eines liturgischen Rituals.
Verdun als Brennglas
Verdun ist ein Ort, an dem Geschichte nicht nur erzählt, sondern eingeatmet wird. Jeder Stein spricht von Trauma, Überleben, Widerstandskraft. Eine Messe zu Ehren Pétains in diesem Umfeld – das wirkt wie ein ungebetener Gast, der sich in ein Familienfoto drängt.
Viele Bürger empfanden genau das. Sie sagten, es verletze das kulturelle Gedächtnis der Nation. Der Bürgermeister sprach von einem Akt mit klarer politischer Zielsetzung. Die Messe war nicht einfach eine Gebetszeit; sie wurde von Gruppen organisiert, die Pétain bis heute als Helden betrachten.
Die Frage drängt sich auf: Warum ausgerechnet hier, warum ausgerechnet jetzt?
Und genau darin liegt der Kern. Orte tragen Bedeutung in sich. Verdun steht für Mut, für Opfer, für republikanische Werte – Werte, die das Vichy-Regime verraten hat. Eine Messe für Pétain an diesem Ort wirkt wie ein bewusstes Spiel mit Symbolen.
Spanien und seine langen Schatten
Auch Spanien tastet sich seit Jahren durch den schwierigen Prozess der Erinnerung. Die Franco-Diktatur ist ein Kapitel, das nicht vollständig abgeschlossen ist. Familiengeschichten, unaufgearbeitete Repressionsfälle, politische Spannungen – alles schwebt wie ein Nebel über dem Land.
In diesem Klima entfalten Messen und Gedenkakte für Franco eine besondere Sprengkraft. Sie liefern Nischen für geschichtsrevisionistische Strömungen, die gerne behaupten, Franco habe das Land „gerettet“. Solche Behauptungen ignorieren die zahllosen Opfer, die Unterdrückung und die erstickte demokratische Kultur.
Einige Priester betonen, es handle sich um rein religiöse Akte. Doch Kritiker fragen: Wie reiner Glaube aussehen soll, wenn er durch politische Botschaften begleitet wird? Und ehrlich gesagt, die Frage hängt im Raum wie eine Glocke, die keiner zum Schweigen bringt.
Ist das nur Nostalgie?
Manche Beobachter sprechen von Nostalgie – aber was für eine Art Nostalgie ist das? Eine Sehnsucht nach autoritärer Ordnung, nach starker Führung, nach einer Zeit, in der komplexe gesellschaftliche Probleme mit eiserner Hand beantwortet wurden?
Diese Seite der Vergangenheit lockt bestimmte Gruppen immer wieder an. Sie sehen in Pétain oder Franco keine Diktatoren, sondern starke Führungsfiguren. Das ist mehr als nur verkitschte Rückschau. Es ist Ideologie.
Allerdings: Es handelt sich nicht um Massenbewegungen. Die Zahl dieser Zeremonien ist gering, die Teilnehmenden oft dieselben, die Medienpräsenz übersteigt ihre soziale Bedeutung um ein Vielfaches.
Aber man darf sich nichts vormachen: Kleine Gruppen können große Signale senden.
Das politische Klima
Die letzten Jahre haben Europa verändert. Populistische Diskurse, Identitätspolitik, historische Fragmentierung – vieles befeuert das Bedürfnis nach einfachen Erzählungen. Gerade in solchen Momenten tauchen Symbole aus vergangenen Zeitaltern wieder auf. Nicht, weil sie harmonisch in die Gegenwart passen, sondern weil sie emotionalisieren.
Die Messen sind Teil eines größeren Spiels. Sie dienen als Testballons. Wie reagiert die Gesellschaft? Wie reagiert der Staat? Wie reagiert die Presse? Manchmal wirkt es, als würden gewisse Akteure gezielt provozieren, um Grenzen abzutasten.
Ein bisschen Alltagssprache: Ganz ehrlich, es nervt viele Leute, weil es so vorhersehbar abläuft. Erst die Provokation, dann der mediale Wirbel, dann die ewig gleiche Debatte.
Doch trotz allem bleibt die Frage: Wie soll eine demokratische Gesellschaft mit solchen Erscheinungen umgehen?
Die Kirche zwischen Liturgie und Politik
In beiden Ländern taucht immer wieder die heikle Rolle der Kirche auf. Kirchliche Räume sind Orte des Glaubens, aber auch Orte der Öffentlichkeit. Wenn politische Symbole hineingetragen werden, beginnt ein Tanz auf dünnem Eis.
Einige Priester lehnen solche Messen strikt ab, andere tolerieren sie, wieder andere segnen sie sogar. Das verwischt die Grenze zwischen Seelsorge und ideologischer Botschaft. Die Kirche selbst findet sich in einer Zwickmühle: Wenn sie verbietet, verstimmt sie Gläubige. Wenn sie duldet, öffnet sie Türen für politische Instrumentalisierung.
Was solche Messen wirklich verraten
In Wahrheit sprechen diese Ereignisse weniger über Pétain und Franco als über unser heutiges Europa. Sie zeigen:
- dass Geschichte nicht abgeschlossen ist,
- dass Erinnerungspolitik ein Feld intensiver gesellschaftlicher Auseinandersetzung bleibt,
- dass autoritäre Fantasien auch im 21. Jahrhundert noch Resonanz finden,
- dass Symbole Macht haben,
- dass Religion und Politik ein explosives Gemisch bilden können.
Diese Ereignisse zeigen zudem, wie brüchig die demokratische Kultur sein kann, wenn man sie ohne Pflege lässt. Erinnern schützt, aber Erinnern ist Arbeit. Viele Menschen spüren inzwischen, dass diese Arbeit unterschätzt wird.
Der juristische Aspekt
Die Debatte in Frankreich wurde zusätzlich durch das juristische Tauziehen verschärft. Der Bürgermeister von Verdun untersagte die Messe, ein Gericht hob die Entscheidung auf. Dahinter steckt ein echtes Dilemma: Wie schützt man die öffentliche Ordnung und die Würde der Republik, ohne die Religionsfreiheit zu beschneiden?
Das Urteil erzeugte Unbehagen, weil es als symbolischer Sieg jener Gruppen verstanden wurde, die Pétain heroisch verklären.
Ein Satz, kurz und knapp.
Doch juristisch betrachtet liegt der Fall kompliziert. Demokratie ist mühsam. Sie schützt auch Dinge, die sie selbst kritisieren muss. Genau das macht sie stark – und angreifbar.
Der menschliche Blick
Als Reporter frage ich mich oft, was Menschen antreibt, an solchen Messen teilzunehmen. Suchen sie wirklich spirituellen Trost? Oder sehnen sie sich nach einer klaren Ordnung, die ihnen die Gegenwart nicht bietet? Vielleicht suchen manche einfach Zugehörigkeit, einen Ort, an dem die Welt nicht so chaotisch wirkt.
Vielleicht ist der beste Vergleich ein alter Dachboden: Staubige Kisten voller Erinnerungen, manche hübsch, manche schmerzhaft. Einige Menschen holen diese Kisten hervor, pusten den Staub weg und erzählen Geschichten, die nicht mehr stimmen. Andere wollen die Kisten endgültig wegwerfen. Und dazwischen stehen viele, die einfach nicht wissen, was richtig ist.
Die europäische Perspektive
Europa ist ein Projekt der Erinnerung. Seine Fundamente liegen im „Nie wieder“. Doch Erinnerung ist dynamisch. Sie muss gepflegt, aktualisiert, vermittelt werden. Das ist kein lästiges Pflichtprogramm, sondern ein sozialer Kitt.
Die Messen für Pétain und Franco zeigen, dass Europa zwar vieles erreicht, aber nicht alles verdaut hat. Für manche ist die Vergangenheit ein Schatz, für andere ein Kampfplatz.
Zwei Fragen drängen sich deshalb auf: Wie redet eine Gesellschaft über ihre eigenen Schatten – und wer bestimmt den Tonfall?
Diese Fragen wirken theoretisch, doch sie betreffen die ganz konkrete Gegenwart. Denn wer Nostalgie für autoritäre Systeme verkleidet, redet oft von Tradition, Nation, Stärke – aber die Konsequenzen dieser Worte stehen in jedem Geschichtsbuch.
Ein letztes Bild
Man stelle sich eine Kirche an einem grauen Novembermorgen vor. Die Glocken läuten, der Wind weht durch kahle Bäume, ein kleiner Kreis von Menschen tritt ein. Manche halten Gebetsbücher, andere halten Fotos, wieder andere nur ihre Überzeugungen. Auf dem Altar brennen Kerzen. Worte werden gesprochen, die nach Frieden klingen. Und doch schleicht sich ein anderer Unterton ein, kaum hörbar, aber vorhanden.
Genau in diesem Unterton steckt die eigentliche Botschaft solcher Messen.
Europa braucht keine Hysterie, aber klugen Blick. Es braucht keine reißerische Empörung, aber klare Positionen. Und es braucht ein Bewusstsein dafür, dass Geschichte nicht verschwindet, nur weil man glaubt, sie abgeschlossen zu haben.
Die Messen für Pétain und Franco sind nicht die Rückkehr alter Regime. Aber sie zeigen, dass deren Geister noch durch Türen schlüpfen können, die einen Spalt offen stehen.
Ein Artikel von M. Legrand
Abonniere einfach den Newsletter unserer Chefredaktion!