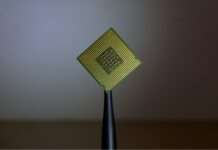Frankreich trocknet aus. Die Sommer werden heißer, die Flüsse kleiner, der Regen seltener. Und mit jeder Dürre wächst der Druck auf eine Institution, die kaum jemand wahrnimmt – es sei denn, sie steht plötzlich vor der Tür: die Umweltpolizei.
Diese Bezeichnung klingt harmlos, fast folkloristisch. Man denkt an Beamte in grünbeigen Westen, die in aller Ruhe am Waldrand patrouillieren. Die Realität ist weniger idyllisch. Die Männer und Frauen des Office français de la biodiversité (OFB) kontrollieren nicht nur, ob Gärten gesprengt oder Pools befüllt werden. Sie stehen für eine neue Frontlinie in der französischen Umweltpolitik – dort, wo staatliche Ordnung auf privates Verhalten trifft.
In Zeiten klimatischer Ausnahmelagen, die längst zur Regel werden, sind klare Bestimmungen unerlässlich. Wasserverbrauch ist kein individuelles Vergnügen mehr, sondern Teil einer kollektiven Überlebensfrage. Und doch trifft jede Einschränkung auf denselben Reflex: Widerstand, Wut, Weigerung.
Gerade in ländlichen Regionen – dort, wo das Wasser auch ökonomisch zählt – stoßen die OFB-Kontrollen auf Misstrauen. Landwirte, für die Wasser kein Luxusgut, sondern Produktionsmittel ist, empfinden viele Maßnahmen als willkürlich. Das Verständnis für das große Ganze – die notwendige Bewahrung der Ressource – bleibt dabei zu oft auf der Strecke. Manche reagieren mit Verweigerung, manche mit offenen Drohungen. Es ist das alte Spiel: Wenn der Staat Grenzen zieht, wird er schnell zum Sündenbock.
Aber in Wahrheit geht es um mehr. Die Umweltpolizei agiert im Spannungsfeld zwischen Ordnungsrecht und Umweltethik. Sie verkörpert den Versuch eines Staates, Verantwortung durchzusetzen, ohne autoritär zu erscheinen. Aufklärung, nicht Einschüchterung, ist das erste Mittel. Kontrolle ersetzt keine Kultur des Maßhaltens – sie kann sie aber befördern.
Natürlich hat diese Kontrolle ihre Grenzen. 1.700 Beamte, verteilt auf das gesamte französische Festland, können keine flächendeckende Überwachung gewährleisten. Das wissen die Verantwortlichen – und sie setzen deshalb auf Kooperation: mit Kommunen, mit Polizei, mit digitalen Mitteln wie dem Portal VigiEau. Was zählt, ist die Wirkung im Alltag. Wenn Bürger:innen selbst nachschlagen, was erlaubt ist – und warum.
Die Zukunft wird trocken. Daran lässt sich kaum noch zweifeln. Und wer sich fragt, ob dieser Einsatz der OFB nicht überzogen ist, dem sei gesagt: Wer keine Regeln durchsetzt, fördert Probleme. Die Polizei des Wassers schützt kein System, sondern die Substanz, auf der alles aufbaut – buchstäblich.
In einer Zeit, in der natürliche Ressourcen zunehmend politisch aufgeladen sind, ist die Umweltpolizei nicht bloß ein Korrektiv – sie ist ein Symbol. Für das Ringen um Gerechtigkeit im Klimawandel. Für die Durchsetzung administrativer Vernunft. Für den Versuch, das Notwendige mit dem Zumutbaren zu versöhnen.
Frankreich wird in den kommenden Jahren viele Debatten über Wasser führen – ökologisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich. Die OFB wird dabei nicht die Lösung sein. Aber ohne sie ist keine Lösung denkbar.
Autor: Andreas M. Brucker
Abonniere einfach den Newsletter unserer Chefredaktion!