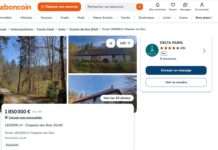Wenn der Internationale Tag der Roma begangen wird, geschieht das nicht ohne Bitterkeit. Denn dieser Gedenktag ist mehr als nur ein Zeichen der Anerkennung für eine der ältesten Minderheiten Europas – er ist auch Mahnung. Mahnung daran, wie tief Vorurteile noch immer in der Mitte der Gesellschaft wurzeln, wie träge politische Systeme auf strukturelle Ungleichheit reagieren und wie unterschiedlich die Antworten darauf ausfallen – besonders, wenn man Deutschland und Frankreich vergleicht.
Die Roma, so heißt es oft, seien „Europäer ohne Land“. Doch das ist mehr als ein romantisches Bild. Es spiegelt auch wider, dass viele Staaten sich schwertun, ihnen einen festen Platz in der Gesellschaft zu gewähren. Während Deutschland zunehmend auf Anerkennung, institutionellen Schutz und Partizipation setzt, bleibt Frankreich bei einem Modell stehen, das vielerorts eher Kontrolle als Integration bedeutet.
Man könnte sagen, Frankreich klammert sich an ein überkommenes Bild: „les gens du voyage“, die Fahrenden, die man verwalten muss – nicht verstehen. Diese Haltung spiegelt sich in der Praxis wider: Räumungen von Camps, bürokratische Hürden für Aufenthaltsgenehmigungen, permanente Unsicherheit. Nicht wenige französische Roma – ob mit Pass oder nicht – leben im ständigen Risiko, ihre Unterkunft, ihr soziales Umfeld oder ihren Zugang zu medizinischer Versorgung zu verlieren. Und wenn doch mal jemand fragt, heißt es schnell: „Das ist ein Sicherheitsproblem.“
Deutschland geht einen anderen Weg. Nicht frei von Widersprüchen, nicht ohne Probleme – aber mit einer bemerkenswerten institutionellen Ernsthaftigkeit. Ein Beauftragter gegen Antiziganismus, Staatsverträge mit den Verbänden, offizielle Gedenkorte für die Opfer des Nationalsozialismus – das sind keine bloßen Symbolgesten. Sie zeigen, dass Integration nicht mit Zwang beginnt, sondern mit Respekt. Und mit dem Willen, historische Schuld nicht nur zu bekennen, sondern auch Verantwortung für die Gegenwart daraus zu ziehen.
Dabei war auch in Deutschland der Weg dorthin steinig. Die Anerkennung der Sinti und Roma als nationale Minderheit kam spät, ihre Repräsentanz in Medien, Politik oder Kultur ist noch heute marginal. Und auch hierzulande lauert Antiziganismus nicht nur am Rand – sondern in Klassenzimmern, auf Ämtern, in alltäglichen Gesprächen. Manchmal gut versteckt hinter einem „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen“, oft genug aber unverhohlen rassistisch.
Frankreich hingegen behandelt die Roma nach wie vor als Ausnahmezustand. Ein Problem, das es zu verwalten gilt. Der Unterschied liegt im Grundton: Deutschland versucht, zu integrieren – Frankreich versucht, zu regulieren. Das Ergebnis? Auf der einen Seite entsteht langsam Vertrauen, auf der anderen Frustration. Auf der einen Seite wachsen Bildungsinitiativen und Selbstorganisationen – auf der anderen geraten ganze Familien in einen Kreislauf aus Räumung und Verdrängung. Man fragt sich: Wie lange lässt sich das noch rechtfertigen?
Dabei liegen die Chancen auf der Hand. Die Roma sind keine homogene Masse, sondern eine europäische Realität – kulturell vielfältig, historisch tief verwurzelt, sozial ambivalent. Man kann in dieser Realität Bedrohung sehen – oder Bereicherung. Wer sich für Letzteres entscheidet, muss aber investieren: in Bildung, in Sprache, in Begegnung. Vor allem aber in Geduld.
Denn es gibt sie, die Erfolgsgeschichten. Roma-Studierende an Universitäten, Künstlerinnen, die europaweit ausstellen, Bürgermeister, die Brücken bauen. Geschichten, die viel zu selten erzählt werden, weil sie nicht ins Klischee passen. Weil sie das Bild stören, das man sich gerne bewahrt – von der Roma-Familie, die sich nicht integrieren will. Vielleicht ist genau das die größte Aufgabe: die Komfortzone der Vorurteile zu verlassen.
Was also tun? Vielleicht braucht es nicht noch mehr Gesetze, sondern mehr Zuhören. Weniger Generalverdacht, mehr individuelle Verantwortung. Und den Mut, auch dort Ressourcen bereitzustellen, wo die politische Rendite gering scheint. Denn wer Integration wirklich will, muss auch bereit sein, unbequem zu werden – für die Mehrheitsgesellschaft.
Der Internationale Tag der Roma ist ein Tag des Erinnerns, ja. Aber mehr noch sollte er ein Tag des Handelns sein. Nicht nur in Reden, sondern im Alltag. In Schulen, Verwaltungen, auf dem Wohnungsmarkt. In Deutschland wie in Frankreich. Zwei Länder, ein Kontinent – und doch so unterschiedliche Wege. Vielleicht ist genau jetzt der Moment, die Perspektiven einander anzunähern. Nicht mit dem moralischen Zeigefinger, sondern mit dem gemeinsamen Blick auf das, was möglich wäre.
Catherine H.
Abonniere einfach den Newsletter unserer Chefredaktion!