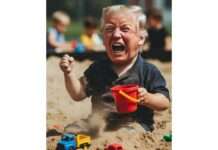Der Hund mag der beste Freund des Menschen sein. Doch seine königliche Schwester, die Katze, bleibt das vielschichtigere Rätsel – eine Kreatur zwischen Schmusebedürfnis und aristokratischer Distanziertheit, zwischen Sofa und Jagdrevier, zwischen Hausfreundin und Halbgöttin. Am 8. August, dem internationalen Katzentag, ist es angebracht, dieser leisen, lautlosen Souveränin des Alltags ihren wohlverdienten Platz in der öffentlichen Aufmerksamkeit einzuräumen.
Denn obwohl sie zu den beliebtesten Haustieren der Welt zählt, ist die Katze ein Wesen, das sich dem Zugriff des Menschen mit subtilem Widerstand entzieht. Sie lässt sich halten, aber nicht besitzen. Liebkosen, aber nicht erziehen. Beobachten, aber selten durchschauen.
Gerade darin liegt ihr Reiz.
Während der Hund dem Menschen seit Jahrtausenden dient – ob auf der Jagd, als Hüter, als Retter –, blieb die Katze in gewissem Sinne immer sie selbst: unabhängig, stolz, von einer Gelassenheit, die oft an Arroganz grenzt. Wer je versucht hat, eine Katze zu etwas zu überreden, was sie nicht will, weiß: Verhandlungen sind zwecklos. Selbst Argumente in Leberwurstform fruchten nur bedingt. Die Katze ist – und das ist ihr größter Triumph – die letzte Anarchistin im Reich der domestizierten Kreaturen.
Doch hinter ihrer stoischen Miene verbirgt sich mehr als nur Eigensinn.
Katzen sind feinfühlige Seismografen der menschlichen Seele. Sie wittern Verstimmungen, ohne einen Ton. Spenden Nähe, wenn man sie am wenigsten erwartet – und ignorieren uns, wenn wir es am dringendsten bräuchten. Das mag kränken, ist aber auch eine stille Form von Integrität. Denn was ist verlässlicher als ein Lebewesen, das nie heuchelt?
Ihre Rolle in Kunst und Kultur ist entsprechend vielschichtig. In der Mythologie wurde sie verehrt – etwa im Alten Ägypten, wo sie als Bastet zur Schutzgöttin erhoben wurde. In der Literatur taucht sie als listige Streunerin (T. S. Eliots Old Possum’s Book of Practical Cats), als magische Gefährtin (Harry Potter) oder als Symbol rätselhafter Schönheit (Baudelaires La Chat) auf. Sie ist Muse und Mahnung, Sinnbild für Unabhängigkeit und das Mysterium des Unergründlichen zugleich.
Im digitalen Zeitalter hingegen ist die Katze – nun ja – vor allem ein Meme.
Ob als „Grumpy Cat“, mit Toastbrot im Gesicht oder bei ihren scheinbar physikalisch unmöglichen Verrenkungen: Sie hat das Internet erobert wie einst die Kornkammern des Niltals. Und das ist kein Zufall. Ihre Mimik ist universell. Ihre Sprünge sind spektakulär. Ihre Körpersprache ist pures Kabarett. Man könnte sagen: Katzen sind die Chaplins unter den Haustieren – nur mit mehr Schnurrhaaren.
Doch so unterhaltsam ihre Präsenz in sozialen Medien auch ist, sie sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Leben vieler Katzen weit weniger glamourös verläuft. In Europa leben Millionen streunender Tiere ohne Schutz, Nahrung oder medizinische Versorgung. Auch in Tierheimen warten unzählige Samtpfoten auf ein Zuhause – oftmals vergeblich. Der Weltkatzentag sollte daher nicht bloß Schnappschüsse feiern, sondern Aufmerksamkeit lenken. Auf Verantwortung. Auf Tierwohl. Auf das leise Leid jener, die sich nicht artikulieren können.
Denn das Wesen der Katze ist zwar unabhängig, aber nicht unberührbar. Sie sucht Nähe – wenn auch zu ihren Bedingungen. Sie braucht Fürsorge – auch wenn sie sie nie einfordern würde. Und sie verdient Schutz – ohne Wenn und Aber.
Bleibt die Frage: Warum lieben wir Katzen eigentlich so sehr?
Vielleicht, weil sie uns einen Spiegel vorhalten. Uns zeigen, wie man durch den Tag geht, ohne sich anzubiedern. Wie man Selbstachtung behält, auch in der Abhängigkeit. Und wie man, bei all dem Stolz, nie die Zärtlichkeit verliert. Wer das schafft, lebt wie eine Katze. Oder zumindest mit einer.
In diesem Sinne: einen schnurrenden Weltkatzentag.
Autor: C.H.
Abonniere einfach den Newsletter unserer Chefredaktion!