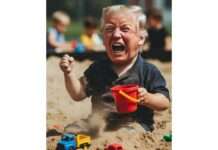Am Montag, dem 13. Oktober 2025, richtet Ägypten in Sharm el-Sheikh einen internationalen Gipfel zur Lage in Gaza aus. Unter dem gemeinsamen Vorsitz des ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi und US-Präsident Donald Trump soll die fragile Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas in einen dauerhaften Friedensprozess überführt werden. Doch während sich rund zwei Dutzend Staats- und Regierungschefs versammeln, bleibt ein zentrales Problem unausgesprochen: Die entscheidenden Akteure des Konflikts – Israel und die Hamas – sind nicht vertreten. Der Gipfel droht damit zum diplomatischen Schaufenster zu verkommen, das mehr Fragen aufwirft, als es Antworten liefert.
Eine fragile Ruhe – und ein ambitionierter Friedensplan
Der Gipfel ist eingebettet in eine außergewöhnliche diplomatische Dynamik: Nach monatelangen Kämpfen in Gaza, die Zehtausende Tote forderten und große Teile der Infrastruktur zerstörten, trat dank eines US-gestützten Plans eine erste Feuerpause in Kraft. Donald Trump positioniert sich nun als zentraler Architekt des Nahost-Friedens. Sein Plan sieht eine schrittweise Demilitarisierung des Gazastreifens, eine Übergangsverwaltung unter internationaler Aufsicht sowie eine spätere Rückkehr der palästinensischen Autonomiebehörde (PA) vor.
Für Ägypten, traditionell Vermittler zwischen Israel und Palästinensern, ist das Treffen nicht minder bedeutend: Al-Sisi nutzt das Forum, um Kairo als unverzichtbare regionale Ordnungsmacht zu inszenieren. Bereits in früheren Phasen des Konflikts hatte Ägypten durch Geheimdienstkontakte und Grenzmanagement entscheidend Einfluss genommen.
Wer fehlt, spricht Bände
Trotz der hohen Symbolkraft des Gipfels fällt eines besonders auf: Israel hat seine Teilnahme abgesagt. Ebenso bleibt die Hamas offiziell dem Treffen fern. Zwar betonen US-Diplomaten, dass informelle Kanäle zur Hamas weiterhin offen seien, doch ohne eine aktive Beteiligung der Konfliktparteien bleibt die Legitimität etwaiger Beschlüsse eingeschränkt. Es ist ein strukturelles Defizit: Friedensverhandlungen ohne die kriegsführenden Parteien haben wenig Aussagekraft.
Diese Leerstelle wirkt besonders schwer, da die Frage der künftigen Verwaltung des Gazastreifens ohne die Mitwirkung der Hamas – die weiterhin über erhebliche soziale wie militärische Strukturen vor Ort verfügt – kaum lösbar erscheint. Selbst die Rückkehr der PA ist mit erheblichen politischen Widerständen verbunden, sowohl in Ramallah als auch in Gaza selbst.
Agenda und geopolitische Interessen
Auf dem Papier verfolgt der Gipfel ambitionierte Ziele: Neben der Einrichtung einer technokratischen Übergangsregierung in Gaza geht es um den langfristigen Wiederaufbau des völlig zerstörten Küstenstreifens. Internationale Geldgeber – darunter die Golfstaaten, die EU und UN-Institutionen – sollen Milliarden für Infrastrukturprojekte, humanitäre Hilfe und Wirtschaftsförderung bereitstellen. Gleichzeitig steht die Errichtung eines internationalen Überwachungsmechanismus zur Sicherung des Waffenstillstands auf der Agenda – ein Modell, das an frühere UN-Missionen im Libanon oder am Sinai erinnert, jedoch mit völlig neuen politischen Vorzeichen konfrontiert ist.
Die USA nutzen den Gipfel natürlich auch zur Rehabilitierung ihrer außenpolitischen Rolle im Nahen Osten. Für Trump persönlich ist die Inszenierung des Friedensarchitekten nicht nur ein außenpolitisches Projekt, sondern Teil einer umfassenden Strategie seiner politischen Wiederauferstehung. Die Präsenz europäischer und arabischer Führer wie Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Recep Tayyip Erdoğan oder der saudischen und emiratischen Außenminister gibt dem Gipfel zusätzliches diplomatisches Gewicht – auch wenn sich hinter dem gemeinsamen Auftritt höchst divergierende Interessen verbergen.
Zwischen Stabilisierung und Symbolpolitik
Ein konstruktiver Impuls aus dem Gipfel lässt sich dennoch nicht ausschließen. Die aktuelle Waffenruhe hat – erstmals seit Monaten – ein Zeitfenster für diplomatische Bewegung geöffnet. Sollte es gelingen, erste Schritte zur zivilen Verwaltung Gazas einzuleiten und eine internationale Schutzstruktur zu etablieren, könnte dies den Grundstein für weiterführende Verhandlungen legen. Doch die zentralen Herausforderungen bleiben schwerwiegend:
- Sicherheitsgarantien: Wer garantiert, dass es nicht erneut zu Eskalationen kommt? Bisherige Versuche internationaler Kontrolle in vergleichbaren Kontexten – etwa im Südsudan – sind gescheitert.
- Politische Legitimation: Weder die PA noch eine internationale Verwaltung genießen derzeit ausreichende Akzeptanz bei der Bevölkerung in Gaza. Die Hamas bleibt trotz ihrer Isolation militärisch präsent und verfügt über tief verwurzelte soziale Netzwerke.
- Finanzierung und Transparenz: Die Erfahrung vergangener Hilfszusagen für Gaza – etwa nach den Kriegen 2009 und 2014 – zeigt, wie schnell Mittel versanden oder zweckentfremdet werden. Ein glaubwürdiger Kontrollmechanismus für die notwendigen Milliardenhilfen ist bisher nicht in Sicht.
Der Gipfel von Sharm el-Sheikh steht somit exemplarisch für die Ambivalenz vieler internationaler Friedensbemühungen: politisch aufgeladen, medial wirksam, aber strukturell schwach verankert. Die Abwesenheit Israels und der Hamas ist mehr als ein diplomatischer Makel – sie legt offen, wie weit Wunsch und Wirklichkeit auseinanderklaffen.
Ob das Treffen über symbolische Gesten hinauskommt, hängt maßgeblich davon ab, ob sich daraus belastbare Folgeformate entwickeln lassen, die eine schrittweise Integration aller relevanten Akteure ermöglichen. Nur dann könnte der Gipfel ein Baustein für eine realistische Friedensarchitektur sein – andernfalls bleibt er ein weiteres Kapitel in der langen Geschichte gescheiterter Nahost-Initiativen.
Von Andreas Brucker
Abonniere einfach den Newsletter unserer Chefredaktion!