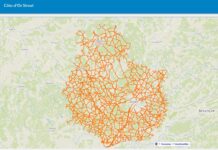Die Herausforderung war unübersehbar, die Botschaft unmissverständlich: Beim Gipfel zur digitalen Souveränität in Berlin forderten Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Friedrich Merz ein selbstbewussteres, strategisch denkendes Europa im digitalen Zeitalter. In einer Phase globaler Systemkonkurrenz drängen die beiden größten Volkswirtschaften der EU auf eine grundlegende Neujustierung europäischer Technologiepolitik – zwischen Silicon Valley und Shenzhen.
Europa, so die zentrale Warnung, dürfe den digitalen Raum nicht länger fremden Kräften überlassen. Die Initiative zielt auf mehr als industriepolitische Selbstbehauptung: Sie ist ein geopolitisches Projekt, das Europas Fähigkeit zur strategischen Gestaltung seiner Zukunft auf den Prüfstand stellt.
Die digitale Abhängigkeit Europas – eine strategische Schwäche
In seiner Rede auf dem Berliner Gipfel sprach Friedrich Merz Klartext: Europa sei „noch viel zu abhängig von US-Software“, insbesondere in Schlüsselbereichen wie Cloud-Infrastrukturen, Betriebssystemen oder KI-Plattformen. Die technologische Rückständigkeit Europas sei nicht nur eine Frage der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit, sondern zunehmend auch eine sicherheitspolitische Achillesferse.
Der Begriff der digitalen Souveränität ist dabei mehr als ein Schlagwort: Er bezeichnet die Fähigkeit, digitale Infrastrukturen, Datenräume, Plattformen und Standards nicht nur zu nutzen, sondern eigenständig zu entwickeln und strategisch zu kontrollieren – jenseits der Abhängigkeit von Google, Microsoft, Amazon oder chinesischen Anbietern wie Huawei oder Alibaba.
Macron sekundierte, betonte aber zugleich den normativen Anspruch eines europäischen Wegs: Innovation müsse im Einklang mit den Rechten und Interessen der Bürger stehen. Fortschritt um jeden Preis sei nicht das Ziel. Vielmehr gehe es um einen technologischen Humanismus, der ökonomische Schlagkraft mit demokratischer Kontrolle verbindet.
Ein alter Traum mit neuer Dringlichkeit
Die Idee einer europäischen digitalen Eigenständigkeit ist nicht neu – sie reicht zurück zu Macrons „Initiative für Europa“ (2017), in der er schon früh für eine europäische Cloud, eigene Plattformen und gemeinschaftliche KI-Forschung plädierte. Doch während die Debatte lange von nationalen Einzelprojekten geprägt war, scheint der geopolitische Druck der vergangenen Jahre – nicht zuletzt durch die technologischen Ambitionen Chinas und die extraterritorialen Ansprüche der USA – eine neue Dynamik erzeugt zu haben.
Merz und Macron greifen damit ein wachsendes Unbehagen auf: Spätestens seit dem Ukraine-Krieg und den damit verbundenen Fragen digitaler Resilienz hat sich in Europa die Erkenntnis durchgesetzt, dass strategische Abhängigkeiten auch in der digitalen Sphäre ein sicherheitspolitisches Risiko darstellen.
Die „digitale Zeitenwende“ – in Anlehnung an das von Olaf Scholz geprägte Konzept zur Verteidigungspolitik – nimmt nun zunehmend Konturen an.
Die deutsch-französische Achse als Motor?
Der Schulterschluss zwischen Paris und Berlin soll dabei nicht nur Symbolpolitik sein. Vielmehr soll die deutsch-französische Achse zum Treiber einer kohärenten europäischen Digitalpolitik werden – inklusive konkreter Vorhaben: Der Aufbau gemeinsamer Rechenzentren, die Förderung europäischer KI-Konsortien, ein digitaler Binnenmarkt mit einheitlichen Standards, ein Rahmen für datenschutzkonforme Innovationen.
Doch es gibt Hürden: Deutschland und Frankreich unterscheiden sich erheblich in ihrer digitalen Infrastruktur, in Regulierungsansätzen und industriepolitischen Traditionen. Während Frankreich stärker zentralistisch mit staatlicher Steuerung agiert, setzt Deutschland stärker auf föderale Ansätze und privatwirtschaftliche Beteiligung. Die Harmonisierung solcher Modelle erfordert politischen Willen und regulatorische Kreativität.
Zudem droht bei mangelnder Koordination die Gefahr einer Fragmentierung des digitalen Binnenmarkts – ein Widerspruch zum Ziel der Souveränität.
Risiken strategischer Autonomie
Der Begriff der „digitalen Souveränität“ bleibt ambivalent. Kritiker befürchten, dass er – falsch verstanden – in Richtung technonationalistischer Abschottung tendieren könnte. Dabei ist europäische Souveränität gerade nicht als nationale Renationalisierung gemeint, sondern als kollektive Handlungsfähigkeit Europas in einer globalisierten, vernetzten Welt.
Zudem besteht das Risiko, dass große Industrieakteure überproportional von neuen Programmen profitieren, während kleinere Mitgliedstaaten und Start-ups kaum Zugang zu Fördermitteln und politischen Gestaltungsräumen erhalten. Die politische Folge wäre wachsender Unmut in jenen Teilen Europas, die sich einmal mehr vom deutsch-französischen Duo überfahren fühlen.
Auch das Timing ist kritisch: Während die USA unter dem Eindruck des technologischen Wettbewerbs mit China Milliarden in ihre Halbleiter- und KI-Branchen investieren, hat Europa noch immer kein entsprechendes Maßnahmenpaket von vergleichbarer Schlagkraft verabschiedet.
Zwischen Anspruch und Umsetzung
Die rhetorische Stoßrichtung des Berliner Gipfels ist eindeutig: Europa soll nicht Getriebener, sondern Gestalter der digitalen Zukunft sein. Das Fenster für strategisches Handeln steht offen – noch. Doch entscheidend wird sein, ob aus der politischen Rhetorik auch ein operatives Projekt wird, das Investitionen, regulatorische Impulse und grenzüberschreitende Kooperation miteinander verbindet.
Ein solches Projekt muss inklusiv angelegt sein, sonst droht es an nationalen Egoismen und administrativen Hürden zu scheitern. Es braucht einen europäischen Konsens über Prioritäten, Ziele und Zeitrahmen – und einen institutionellen Rahmen, der nicht nur Visionen formuliert, sondern Fortschritt messbar macht.
Die Chancen dafür stehen nicht schlecht: Mit Merz und Macron stehen zwei Politiker an der Spitze, die den digitalen Rückstand Europas als strategisches Risiko erkennen – und gleichzeitig über die politische Autorität verfügen, die Debatte auf EU-Ebene zu kanalisieren.
Wie nachhaltig dieser Impuls ist, wird sich an konkreten Weichenstellungen zeigen: an Förderinstrumenten, an gemeinsamen Standards, an der Bereitschaft, auch unbequeme Entscheidungen gegen etablierte Interessen durchzusetzen.
Europa steht an einem Scheideweg: Entweder es bleibt Nutzer fremder Technologien – oder es entwickelt sich zum souveränen Akteur der digitalen Moderne. Der Gipfel von Berlin war ein Signal. Nun muss die politische Architektur folgen.
Autor: P. Tiko
Abonniere einfach den Newsletter unserer Chefredaktion!