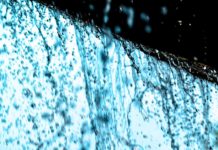Paris ist schön. Paris ist stolz. Paris ist fragil.
Ab dem 13. Oktober 2025 spielt sich in der französischen Hauptstadt ein ganz besonderes Theaterstück ab: eine fiktive Sintflut. Die Behörden simulierten eine Jahrhundertflut der Seine, als würde das Wasser morgen schon über die Ufer treten und sich die Metropole unter den Nagel reißen. Man übt Rettung, Evakuierung, Notkommunikation – und sonnt sich gleichzeitig in der Gewissheit, vorbereitet zu sein.
Doch diese Gewissheit ist trügerisch.
Denn während man in Gummistiefeln durch gedachte Hochwasserzonen stapft, spielte sich ein anderes, stilleres Drama ab: das totale Verkennen der Ursachen.
Ja, der Klimawandel ist in Paris angekommen. Aber statt ihn zu bekämpfen, inszenieren wir seine Folgen wie eine Naturkatastrophe, die uns plötzlich und ohne Vorwarnung heimsucht. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall.
Die Katastrophe ist nicht hypothetisch. Sie ist hausgemacht.
Wer glaubt, dass eine sogenannte „crue centennale“ – also eine Flut mit einer 1-prozentigen jährlichen Wahrscheinlichkeit – ein reines Naturphänomen ist, hat nicht verstanden, was hier auf dem Spiel steht. Die Seine steigt nicht aus Jux und Tollerei über ihre Ufer. Sie tut das, weil jahrzehntelang gebaut, versiegelt, verdichtet wurde – ohne Rücksicht auf Wasserkreisläufe, natürliche Puffer oder ökologische Logik. Paris hat sich in ein steinernes Becken verwandelt, in dem Regen nicht mehr versickert, sondern wartet. Auf den großen Knall.
Die Übung ist gut gemeint. Sie ist wichtig. Aber sie ist auch ein Symbol für eine gefährliche Strategie: Symptombekämpfung statt Ursachenanalyse.
Was nützt ein perfekt geölter Evakuierungsplan, wenn man die Klimakatastrophe nicht verhindert, sondern verwaltet?
Verstehen wir uns nicht falsch: Es ist absolut richtig, auf den Notfall vorbereitet zu sein. Doch während Feuerwehrleute und Rotkreuzhelfer Evakuierungswege testen, fahren auf der anderen Seite der Stadt weiterhin SUVs durch Viertel, die bei der nächsten Starkregenfront unter Wasser stehen könnten. Man diskutiert über Notstromaggregate – aber nicht über Energiereformen. Man füllt Sandsäcke – aber entwickelt keine Klimapolitik mit Rückgrat.
Und dann steht da noch der Elefant im Raum: die soziale Ungleichheit der Katastrophe.
Denn wer wird bei der nächsten realen Flut in Paris wirklich leiden? Wer wohnt in schlecht isolierten Kellergeschossen? Wer hat keine Rücklagen, keine Netzwerke, keine Möglichkeit, einfach ins Haus in der Provence zu fliehen? Sicher nicht die Entscheider in den oberen Etagen der Haussmann’schen Altbauten. Sondern die Alten, die Armen, die Alleingelassenen.
Solche Simulationen, so nützlich sie auf dem Papier sind, offenbaren vor allem eines: unsere selektive Blindheit. Wir sehen das Wasser kommen – aber nicht, was es mit sich reißt.
Warum trauen wir uns nicht, die Krise beim Namen zu nennen?
Weil es unbequem ist. Weil es Veränderung braucht. Weil man plötzlich über CO₂-Budgets, Stadtbegrünung, Verkehrsberuhigung, Rückbau und soziale Gerechtigkeit reden müsste. Weil man anerkennen müsste, dass nicht die Flut das Problem ist – sondern wir.
Vielleicht sollte Paris beim nächsten Mal nicht die Flut simulieren, sondern die Utopie: eine autofreie Innenstadt, begrünte Dächer, entsiegelte Plätze, gerechte Mieten, entschlossene Politik. Das wäre radikal. Und vielleicht sogar realistisch – wenn man nur will.
Bis dahin bleibt uns das Planschbecken der Simulation.
Aber wehe, das Wasser wird echt.
Dann wird Paris nicht nur überflutet.
Dann wird Paris entlarvt.
Ein Kommentar von C.H.
Abonniere einfach den Newsletter unserer Chefredaktion!