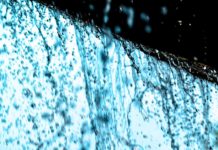Am 20. Oktober 2025 verwandelte sich der Himmel über Ermont im Département Val-d’Oise in ein tosendes Chaos. Böen mit bis zu 200 km/h rissen Kräne von Baustellen, Dächer flogen davon, eine Person kam ums Leben, mehrere wurden verletzt. Eine Szene wie aus dem Mittleren Westen der USA – nur eben mitten in der Île-de-France.
Und sofort stellt sich die Frage: Sind Tornados in Frankreich tatsächlich so selten, wie man glaubt?
Ein Ausnahmephänomen – das immer weniger überrascht
In der Vorstellung vieler gehören Tornados nach Oklahoma oder Kansas, nicht in die Oise oder Picardie. Doch die Statistik spricht eine andere Sprache: Im Durchschnitt werden in Frankreich jedes Jahr rund vierzig Tornados registriert – mal stärker, mal schwächer, aber deutlich regelmäßiger, als viele annehmen.
Meist bleiben sie unbemerkt. Sie entstehen über Feldern, verlieren sich nach wenigen Minuten, reißen ein paar Bäume nieder und verschwinden wieder. Dennoch sind sie meteorologisch hochinteressant: Sie zeigen, dass auch das französische Klima die Bedingungen für solche Wirbelstürme bietet.
Die vermeintliche „Seltenheit“ ist also eher eine Frage der Wahrnehmung. Tornados sind kleinräumige Phänomene – ihre Schneisen nur wenige Hundert Meter lang – und werden deshalb leicht übersehen. Selbst Météo-France gibt an, dass viele zwischen den Maschen der Überwachung hindurchgleiten.
Warum man Tornados kaum vorhersagen kann
Das Faszinierende und zugleich Beunruhigende: Man kann Tornados nicht punktgenau vorhersagen. Meteorologinnen und Meteorologen erkennen zwar die Zutaten – starke Gewitter, instabile Luftschichten, Windscherung, eventuell eine Superzelle –, aber wann und wo sich der Wirbel bildet, bleibt in den meisten Fällen unberechenbar.
Auch am 20. Oktober war der Kontext klar: Keraunos, das französische Tornado-Observatorium, hatte bereits einen „Tornado-Tag“ angekündigt. Trotzdem traf die Windhose Ermont ohne gezielte Vorwarnung. Eine Wetterstation in Achères, nur zehn Kilometer entfernt, maß um 17:35 Uhr harmlose 51 km/h – nur Minuten später wütete der Sturm.
Das zeigt, wie rasend schnell sich solche Ereignisse entwickeln. Wettermodelle simulieren Großwetterlagen, aber Tornados sind lokale, flüchtige Erscheinungen – zu fein, zu plötzlich, um sie mit heutiger Rechentechnik exakt vorherzusagen.
Klein, aber verheerend
Die meisten Tornados in Frankreich erreichen die Stufen EF0 bis EF1 auf der sogenannten Fujita-Skala – das bedeutet Windgeschwindigkeiten zwischen 105 und 180 km/h. Das klingt harmloser, als es ist. In dicht besiedelten Gebieten reichen solche Böen, um Bäume zu entwurzeln, Dächer abzudecken und Autos umzuwerfen.
Die Tornado-Schneise von Ermont war nur wenige Hundert Meter breit, aber sie reichte aus, um Kräne umstürzen zu lassen. Die Kombination aus hoher Bebauungsdichte und Bauweisen, die auf derartige Belastungen nicht ausgelegt sind, verstärkt die Schäden.
Der Tornado bleibt ein flüchtiges Phänomen – meist vorbei, bevor man ihn filmen kann. Genau das macht ihn so tückisch.
Wird der Klimawandel Tornados häufiger machen?
Die Forschung steht noch am Anfang. Eine aktuelle europäische Studie zählt jährlich etwa 700 Superzellen – das sind die Mutterschiffe, aus denen Tornados entstehen können. In einem Szenario mit drei Grad Erderwärmung könnte ihre Zahl um rund elf Prozent steigen.
Das bedeutet nicht automatisch mehr Tornados. Manche Regionen, etwa Südwestfrankreich, könnten sogar seltener betroffen sein, während in Mittel- und Osteuropa das Risiko zunimmt. Denn Tornados entstehen aus einem Zusammenspiel von Mikrobedingungen – Temperatur, Feuchtigkeit, Windscherung, Zündimpuls – und diese hängen nur teilweise vom globalen Klima ab.
Trotzdem: Eine wärmere Atmosphäre kann stärkere Energiepotenziale schaffen. Und je energiereicher das Wetter, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass auch in Frankreich künftig häufiger extreme, lokal begrenzte Wirbelstürme entstehen.
Was bleibt nach Ermont?
Vier Dinge. Erstens: Tornados sind in Frankreich selten, aber keineswegs unmöglich. Zweitens: Sie lassen sich kaum punktgenau vorhersagen. Drittens: Ihre Schäden können erheblich sein, gerade in dicht besiedelten Gebieten. Und viertens: Der Klimawandel wird die Bedingungen dafür begünstigen – wenn auch regional unterschiedlich.
Der Fall Ermont ist damit mehr als nur eine meteorologische Kuriosität. Er ist ein Weckruf.
Denn das eigentliche Risiko liegt nicht im Himmel – sondern darin, dass wir glauben, so etwas könne bei uns nicht passieren.
Autor: Andreas M. Brucker
Abonniere einfach den Newsletter unserer Chefredaktion!