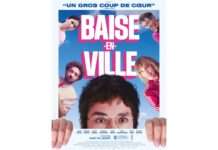Man muss nur die Hallen betreten, um zu verstehen, warum dieser Ort seit 1975 überdauert hat. Der Duft von frischen Kräutern, das Knarzen der Holzkisten, das leise Gemurmel der Stammkundschaft – hier, im Herzen von Villeneuve-sur-Lot, schlägt das älteste Biomarktherz Frankreichs.
Seit fünf Jahrzehnten treffen sich rund dreißig Händler, um ihre Ernte anzubieten: Brot, Käse, Trauben, Sellerie, Honig. Alles echt, alles handgemacht, nichts Überflüssiges. Zwischen den Ständen spürt man eine Art ruhige Gewissheit – die Überzeugung, dass gutes Essen mehr ist als bloße Ernährung.
„Was zählt, ist, dass die Leute sich gut ernähren“, sagt Henri Barbot, ein wettergegerbter Mann mit weichen Augen, der seit 26 Jahren hier steht. Kein Werbespruch, kein Pathos – einfach Überzeugung pur.
Wo alles begann
- In Paris diskutiert man über Umweltpolitik, in Villeneuve pflanzen ein paar Bauern ohne Chemie. Damals war „bio“ ein Fremdwort, fast eine Spinnerei. Doch hier, im Lot-et-Garonne, fanden sich Menschen, die etwas anderes wollten: Boden, Sonne, Regen – sonst nichts.
„Wir waren damals ein bisschen verrückt“, erinnert sich Laurent Pouget, einst Präsident des Marktes. „Aber diese Verrücktheit hat uns verbunden.“
Er lacht, während er seine Hände in die Taschen steckt – Hände, die so viel Erde gesehen haben, dass sie fast Teil davon sind.
Heute ist der Markt längst Institution. Ein Mittwochsritual, das zu Villeneuve gehört wie das Läuten der Kirchenglocken.
Eine Region, die trägt
Die Vallée du Lot ist ein Garten. Fruchtbare Böden, milde Winter, ein Fluss, der Leben spendet. Schon früh fragten sich die Menschen hier: Was landet eigentlich auf unseren Tellern? Und warum?
„Die Bio-Bewegung hat sich hier nicht eingeschlichen, sie ist explodiert“, sagt Pouget. „Es war fast zwangsläufig.“
Man merkt ihm den Stolz an – nicht den lauten, sondern den stillen. Den eines Landwirts, der weiß, dass seine Erde mehr kann, als bloß zu liefern.
Gemeinschaft unter Hallendächern
Mittwochmorgen, kurz vor acht. Die Sonne dringt durch die Glasdächer, der Markt erwacht. Stimmen mischen sich mit dem Klirren von Weckgläsern, Kinder rennen zwischen den Beinen der Erwachsenen hindurch.
„Wir haben eine besondere Kundschaft“, erzählt Pierre Pernix, der aktuelle Vorsitzende. „Treue Menschen, fast schon Mitstreiter.“
Er sagt das nicht mit Überheblichkeit, sondern mit Wärme. Diese Leute kaufen nicht nur ein – sie glauben an eine Idee.
Doch selbst dieser Glaube wackelt gelegentlich. Inflation, Zeitmangel, Bequemlichkeit – die großen Gegenspieler des Wochenmarkts. „Wir dachten, Corona würde die Lust aufs Lokale verstärken“, seufzt Pernix, „aber das war nur ein Strohfeuer.“
Das Vorurteil vom teuren Bio
„Zu teuer, sagen sie immer“, murmelt Barbot, während er Tomaten sortiert. „Aber haben sie mal genau hingesehen?“
Er nimmt eine Frucht in die Hand, wiegt sie, lächelt. „Wenn man Qualität und Frische vergleicht, sind wir oft günstiger als die Supermärkte.“
Der Mythos vom Luxus-Bio klebt hartnäckig an der Branche. Dabei steckt der wahre Preis im Unsichtbaren: in sauberem Wasser, gesunden Böden, kurzen Wegen. In Vertrauen.
Wie misst man das? Gar nicht. Man schmeckt es – oder man schmeckt es eben nicht.
Ein Markt als Klassenzimmer
Zwischen den Ständen hüpfen Kinder, schnuppern an Kräutern, staunen über lilafarbene Karotten. Eine Mutter beugt sich zu ihrer Tochter: „Weißt du, was das ist?“
Das Mädchen schüttelt den Kopf. „Ein Rübenkönig“, antwortet die Mutter lachend, während die Kleine kichert.
„Das ist unser wichtigster Auftrag“, sagt Jacques Réjalot, Winzer und Schriftführer der Marktsgemeinschaft. „Kinder sollen sehen, wo Essen herkommt. Wie’s riecht, wenn’s echt ist.“
Er redet wie ein Lehrer, der seine Schule liebt. Denn für ihn ist der Markt kein Verkaufsplatz – er ist eine Bühne der Bildung, Woche für Woche.
Zwischen Tradition und Zukunft
Doch wer genau hinschaut, sieht: Das Publikum altert. Viele graue Köpfe, weniger junge Gesichter.
„Wir fragen uns wirklich, wer unsere Kunden von morgen sein werden“, meint Pernix ernst.
Es ist eine berechtigte Frage. Denn auch wenn das Ideal des „bio“ längst gesellschaftlich angekommen ist, bleibt der Gang zum Markt für viele eine Ausnahme.
Aber hier gibt man nicht auf. „Man muss Geduld haben – wie bei einem guten Wein“, sagt Réjalot. „Wenn man die Saat legt, kommt irgendwann auch die Frucht.“
Kein Ort für Moden
In einer Welt, in der Trends so schnell wechseln wie Fernsehprogramme, wirkt Villeneuve-sur-Lot fast trotzig. Hier gibt’s keine hippen Smoothie-Bars, keine glitzernden Etiketten. Nur Tische, Körbe, Erde, Schweiß – und Ehrlichkeit.
„Modeerscheinungen interessieren mich nicht“, meint Barbot schlicht. „Was zählt, ist, dass wir respektvoll mit der Natur umgehen.“
Seine Worte hallen nach. Weil sie echt sind. Weil sie nichts versprechen, sondern leben, was sie sagen.
Zwischen den Zeilen der Zeit
Fünfzig Jahre – das sind Generationen, Stürme, Wirtschaftskrisen. Der Markt hat alles überstanden. Warum?
Weil hier kein Konzept verkauft wird, sondern Haltung.
Weil die Leute, die kommen, nicht nur einkaufen – sie suchen Nähe, Gespräch, Sinn.
Und vielleicht ist das das Geheimnis: Wer mittwochs hier steht, hat für einen Moment das Gefühl, die Welt sei noch ein bisschen im Gleichgewicht.
Eine Zukunft, die nach Brot duftet
Wenn man am Ende des Vormittags durch die leeren Hallen läuft, sieht man die letzten Spuren eines lebendigen Rituals: ein paar Gemüseschalen, Brotreste, Spuren von Erde.
Die Sonne steht schon höher. Die Händler laden ein letztes Mal aus, reden, lachen, verabreden sich für nächste Woche.
Wird es den Markt in weiteren fünfzig Jahren noch geben?
Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber solange Menschen wie Barbot, Pouget und Pernix hier stehen – mit Herz, mit Haltung, mit Humor – wird er leben.
Denn Märkte wie dieser sterben nicht. Sie atmen.
Ein Artikel von M. Legrand
Abonniere einfach den Newsletter unserer Chefredaktion!