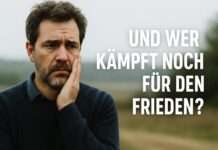Sébastien Lecornu war französischer Premierminister – allerdings nur kurz. Nach 27 Tagen im Amt und nur wenigen Stunden nach der Vorstellung seines Kabinetts war schon wieder Schluss. Eine Farce? Ein Albtraum? Oder schlicht Ausdruck einer politischen Realität, die Frankreichs Institutionen zunehmend sprengt?
Ein Blick in die Presselandschaften Deutschlands und Großbritanniens zeigt: Der Nachhall dieser Rücktrittsposse hallt weit über Frankreich hinaus – und was man darin liest, klingt alarmierend.
Großbritannien: Ein Land blickt kopfschüttelnd über den Ärmelkanal
Die britische Presse liebt große Gesten, starke Bilder, ironische Zwischentöne. Genau das spiegelt sich in ihrer Berichterstattung über Frankreichs Regierungskrise.
„Chaotisch“ lautet das zentrale Schlagwort. Lecornus Rücktritt wird als Symbol völliger Regierungsunfähigkeit gedeutet. Kommentatoren betonen, dass in Frankreich das Prinzip des Kompromisses offenbar ausgedient habe – Parteien agieren wie verfeindete Lager, die lieber alles blockieren, als gemeinsam Verantwortung zu tragen. Und in der Mitte: ein Präsident, der zunehmend wirkt wie ein Statist auf der eigenen Bühne.
Das politische Drama wird dabei eng mit wirtschaftlichen Risiken verknüpft. Börsen reagieren nervös, der Euro schwächelt, die Renditen französischer Staatsanleihen steigen. Es klingt, als traue man Frankreich keine ernsthaften Reformen mehr zu. Ein Premier, der schneller geht als kommt, sendet das falsche Signal – vor allem an Investoren.
Zwischen den Zeilen schwingt auch ein kultivierter Spott mit. „Sacre bleu!“ – nicht wörtlich, aber als Haltung. Die Idee eines Frankreichs, das brillant, impulsiv, aber im Grunde unregierbar ist, passt zu britischen Erzählmustern. Und doch: Hinter der Ironie liegt echtes Unbehagen. Denn wenn eine der wichtigsten Nationen Europas ins institutionelle Trudeln gerät, ist das keine französische Affäre mehr – sondern ein europäisches Problem.
Deutschland: Analyse statt Drama – aber mit düsterem Unterton
Ganz anders die Tonlage in der deutschen Presse. Keine schmissigen Überschriften, keine spitzen Kommentare – dafür umso mehr Analyse, Zahlen, Systemkritik.
Man spricht von „Dauerkrise“, von einer „instabilen politischen Lage“, von einer „strukturellen Blockade“. Lecornus Rücktritt gilt nicht als Ausrutscher, sondern als Symptom einer tiefer liegenden Krankheit: Frankreichs politische Architektur kommt mit der realen Parteienlandschaft nicht mehr zurecht.
Besonders deutlich wird das bei der Haushaltsproblematik. In mehreren Artikeln wird gewarnt, dass Frankreichs Budgetplanung ins Wanken geraten könnte. Ohne klare Mehrheiten und stabile Regierungsführung seien weder Reformen noch Investitionsprogramme verlässlich umsetzbar. Der Ton ist sachlich, aber unterschwellig alarmiert: Wenn Paris wackelt, wackelt auch die Eurozone.
Einige Kommentare gehen noch weiter und fordern ein politisches „Loslassen“ – Macron müsse lernen, Macht zu teilen. Andere fragen offen, ob Frankreich noch regierbar ist. Diese Frage wirkt zunächst provokant, offenbart aber die Sorge, dass sich Frankreichs Demokratie in eine Sackgasse manövriert haben könnte.
Und zwischen all der Nüchternheit schleicht sich ein Gedanke ein, der fast revolutionär klingt: Frankreich, so heißt es einmal, sei „reif für einen politischen Umbruch“.
Was die internationalen Schlagzeilen gemeinsam haben
So unterschiedlich die Tonlagen – das Urteil ist ähnlich.
Erstens: Frankreich erscheint als unregierbar. Präsident und Parlament blockieren sich gegenseitig, während Regierungschefs im Monatsrhythmus das Handtuch werfen. Das Wort „Impasse“ – politisches Patt – taucht auffallend häufig auf, vor allem in der deutschen Berichterstattung.
Zweitens: Die wirtschaftlichen Folgen stehen im Zentrum. Beide Länderpressehäuser sehen eine direkte Verbindung zwischen Instabilität in Paris und Reaktionen auf den Finanzmärkten. Vertrauen schwindet, Risiken steigen – das ist der Subtext jeder zweiten Analyse.
Drittens: Macron selbst gerät ins Zentrum der Kritik. Manche fragen, ob es nicht an der Zeit sei, die eigene Rolle zu überdenken. Denn wer immer wieder Premiers benennt, die im politischen Maschinenraum sofort zerrieben werden, verliert irgendwann selbst an Autorität.
Und was zwischen den Zeilen mitschwingt
Interessanterweise wird eines selten thematisiert: die französische Öffentlichkeit. Was bedeutet all das für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger? Wie lange lassen sich solche Regierungsexperimente noch durchhalten, ohne dass eine größere politische Erschütterung folgt?
Und dann ist da noch die europäische Dimension. Besonders in deutschen Kommentaren wird zwar auf mögliche Folgen für die EU hingewiesen – aber was das konkret für gemeinsame Projekte, die deutsch-französische Zusammenarbeit oder Europas Rolle in der Welt bedeutet, bleibt vage.
Vielleicht liegt genau hier die größte Leerstelle: Frankreichs politische Dauerkrise hat das Potenzial, die europäische Architektur zu destabilisieren. Nur traut sich das bislang kaum jemand laut auszusprechen.
Oder traut man es sich einfach nicht zu denken?
Autor: Andreas M. Brucker
Abonniere einfach den Newsletter unserer Chefredaktion!