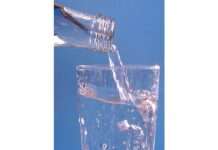Ein stiller Abschied hat längst begonnen. Kein großer Knall, keine Sirenen, nur das stetige, leise Tropfen von Schmelzwasser. 2025 steht offiziell im Zeichen der Gletscher. Die Vereinten Nationen rufen dazu auf, dieses Jahr der Erhaltung dieser faszinierenden Eisriesen zu widmen. Warum? Weil sie rasant verschwinden – und mit ihnen ein wertvolles Stück unseres natürlichen Gleichgewichts.
Gletscher sind weit mehr als postkartenreife Landschaften. Sie sind Süßwasserspeicher, Klimazeugen, Lebensgrundlage. Und sie sind in Gefahr wie nie zuvor.
Eis von gestern: Das Mer de Glace schrumpft
Wer vor hundert Jahren durchs Tal nahe Chamonix wanderte, konnte das „Mer de Glace“ noch bis in die Tiefe des Tals herabkommen sehen. Heute? Eine trockene Furche, ein zerfurchter Canyon. Der größte Gletscher Frankreichs hat über die Hälfte seiner Fläche verloren – in nur einem Jahrhundert.
Und er ist kein Einzelfall. Weltweit geht es Tausenden Gletschern ähnlich. Der Rückgang sei „ohne Beispiel in den letzten 2000 Jahren“, sagt der Weltklimarat IPCC. In Klartext: Die Gletscher schmelzen nahezu überall – gleichzeitig.
Ein beängstigendes Bild. Und eines, das sich nicht einfach wegdiskutieren lässt. Der Mensch steht im Zentrum dieses Eisdramas. Nicht als Zuschauer, sondern als Hauptdarsteller.
Achterbahnfahrt ins Schmelzwasser
Seit den 1990ern beschleunigt sich das Schmelzen. Daten des World Glacier Monitoring Service belegen: Zwischen 1976 und heute verloren die Gletscher weltweit über 8.200 Gigatonnen Eis. Das sind mehr als 8.000 Milliarden Tonnen. Verrückt, oder?
Und das Tempo steigt. Der Weltklimarat warnt: Selbst wenn wir heute aufhören würden, Treibhausgase auszustoßen – viele Gletscher würden trotzdem noch Jahrzehnte, sogar Jahrhunderte weiter schmelzen. Der Zug rollt. Aber wohin?
Je nachdem, ob sich die globale Erwärmung bei 1,5°C oder bei 4°C einpendelt, könnten bis 2100 zwischen einem Viertel und fast der Hälfte der Gletschermasse verloren gehen. Und dabei sprechen wir von Daten im Vergleich zu 2015. Das ist… erschreckend.
Vom Himalaya bis Patagonien: Die Eisriesen wanken
Es gibt mehr als 275.000 Gletscher auf unserem Planeten. 96 Prozent davon werden überwacht – sei es vom Boden oder aus dem All. Und fast alle zeigen dasselbe Bild: Rückzug, Schwund, Abschied.
Einige Regionen sind besonders betroffen: Der Süden der Anden, Neuseeland, Alaska, Island und – unsere geliebten Alpen. Auch hier verliert das ewige Eis an Boden. Jahr für Jahr.
Ein kleines Beispiel gefällig? 2023 war ein katastrophales Jahr für Gletscher weltweit. Keine Region zeigte eine positive Bilanz. Laut der Weltorganisation für Meteorologie ging so viel Eis verloren, wie in der fünffachen Menge der Wassermasse der gesamten Toten See steckt. Ja, richtig gelesen – fünf Mal so viel.
Und 2024? Steuert auf ähnliche Rekorde zu. In Schweden wurde die stärkste Schmelze seit 80 Jahren verzeichnet. In Asien ist der Trend nicht besser – wenig Schnee im Winter, extreme Hitze im Sommer. Ein Duo, das Gletschern gar nicht schmeckt.
Frankreichs Gletscher – ein Blick ins eigene Land
Frankreich schaut besonders auf sieben Gletscher – in den Alpen und den Pyrenäen. Diese symbolisieren den Zustand der restlichen Eisflächen. Seit 2001 verloren sie im Schnitt 31 Meter an „Wasseräquivalent“. Klingt abstrakt? Stell dir einfach vor, man hätte mehr als 30 Meter Eisdicke abgehobelt.
Der Sarenne-Gletscher in der Alpe d’Huez hat es nicht geschafft. Er ist verschwunden. Auf Skikarten war er einst prominent verzeichnet. Heute ist er Geschichte.
Warum das passiert? Weniger Schnee im Winter, mehr Hitze im Sommer. Und noch etwas: Staub. Ja, richtig – Staub, der sich auf das Eis legt, es dunkler macht und somit mehr Sonnenstrahlung aufsaugt. Das beschleunigt das Schmelzen zusätzlich.
Vor 30 Jahren begann die Schmelzsaison im Juli. Heute? Schon im Mai. Und sie dauert oft bis in den Oktober. Das ist ein halbes Jahr Eisverlust – jedes Jahr.
Wenn die Gletscher weinen, steigt das Meer
Ein weiterer Effekt: Der Meeresspiegel. Zwischen 1971 und 2018 stieg er um gut 21 Millimeter – allein durch Gletscherschmelze. Das klingt erstmal wenig, oder? Aber in globalen Maßstäben ist das gewaltig.
Und es geht weiter. Sollten alle Gletscher schmelzen, würde der Meeresspiegel um 32 Zentimeter steigen. Das klingt plötzlich gar nicht mehr so harmlos.
Ein Anstieg, der Millionen von Menschen in Küstengebieten gefährden würde. Städte wie Jakarta, New York, Lagos – sie alle könnten Land und Wohnfläche verlieren. Nicht irgendwann, sondern innerhalb weniger Generationen.
Gletscher: Unsere natürlichen Wasserspeicher schwinden
Gletscher sind nicht nur Eisberge zum Bestaunen. Sie sind Wasserspeicher, die in heißen Sommern unsere Flüsse speisen. Für Strom, Landwirtschaft, Industrie – für unser Leben.
1,2 Milliarden Menschen leben weltweit in Bergregionen. Allein in Europa sind es fast 116 Millionen. Für viele bedeutet ein Gletscherfluss: Wasser im Sommer. Energie. Nahrung.
Doch dieser Rhythmus gerät aus dem Takt. Die Flüsse führen anfangs noch mehr Wasser – weil das Eis schmilzt. Aber irgendwann ist Schluss. Dann versiegt die Quelle. Die Arve, ein Fluss aus dem Mont-Blanc-Gebiet, hat diesen Punkt bald erreicht. Die Forschungen zeigen: Der Höhepunkt der Schmelzwasser-Mengen ist da – oder schon überschritten.
Und dann? Dann trocknet das System aus. Wie soll man im Sommer Felder bewässern, wenn der Gletscher nur noch Geröll hinterlässt?
Klimawandel bedeutet auch: Wassernot
Noch ein Zitat der Vereinten Nationen, das unter die Haut geht: „60 Prozent der weltweiten Süßwasserressourcen stammen aus den Bergen.“
Aber der Wasserfluss – Schnee und Gletscher – wird zur Mangelware. Wenn der Schnee ausbleibt und das Eis schrumpft, dann bleibt nur noch eins: Dürre.
Für die Alpen prognostiziert der UN-Bericht einen Rückgang des jährlichen Flusswassers um 35 Prozent bis 2100. Im Sommer dürfte es sogar noch dramatischer werden.
Wer hätte gedacht, dass die Debatte um Gletscherschmelze eigentlich eine über die globale Wasserkrise ist?
Was jetzt?
Es fühlt sich oft an wie ein aussichtsloser Kampf gegen eine Lawine. Doch Hoffnung ist kein Fremdwort. Technologischer Fortschritt, neue Datenmodelle und präzisere Vorhersagen ermöglichen heute bessere Entscheidungen als je zuvor. Die Wissenschaft arbeitet – grenzübergreifend, disziplinenübergreifend, engagiert.
Aber reicht das?
Vielleicht ist jetzt der Moment, um neu zu denken. Nicht nur mit Blick aufs Eis, sondern auf unser gesamtes Verhältnis zur Natur. Denn Gletscher sind nicht nur Messinstrumente des Klimawandels – sie sind Mahnmale.
Und ja, sie erzählen auch Geschichten. Geschichten von Kälte, von Beständigkeit, von Zeit. Doch gerade jetzt schreiben sie ein neues Kapitel. Eins, das wir noch wenden können.
Oder wollen wir einfach zusehen, wie sie still verschwinden?
Von Andreas M. Brucker
Quellen: IPCC, Copernicus, WGMS, ONU, OMM, franceinfo, Nature
Abonniere einfach den Newsletter unserer Chefredaktion!